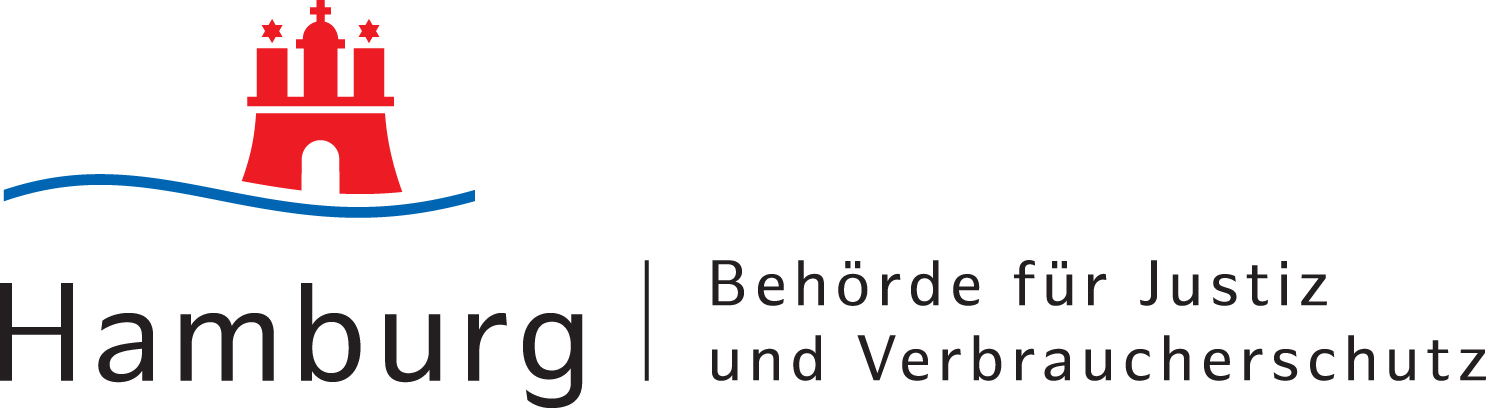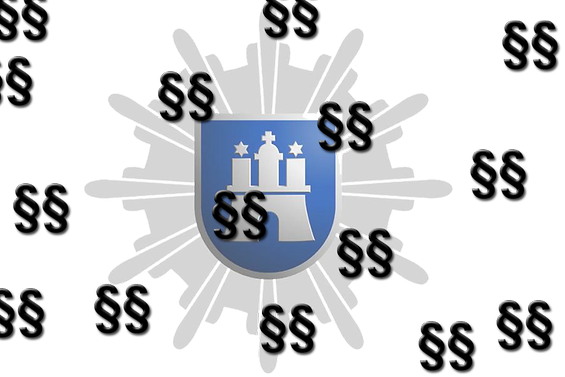Vollstreckung von Geldstrafen, Ratenzahlung und gemeinnützige Arbeit
Die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde.

Nach § 451 der Strafprozessordnung (StPO) ist die Staatsanwaltschaft Vollstreckungsbehörde für Urteile und Strafbefehle im Erwachsenenstrafrecht. Sie trifft daher die Maßnahmen, die zur Einleitung und Überwachung der Vollstreckung einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Entscheidung, also von Urteilen und gleichstehenden Entscheidungen, erforderlich sind. Dies betrifft u.a. die Vollstreckung von Geldstrafen.
Vollstreckung von Geldstrafen durch die Staatsanwaltschaft
Die Geldstrafe wird durch Urteil oder Strafbefehl verhängt. Sie ist ein Produkt aus Strafmaß (Anzahl der Tagessätze) und dem Tagesnettoeinkommen des Verurteilten. Die Höhe des Strafmaßes richtet sich nach der Schwere der Tat, die Höhe der Tagessätze nach den wirtschaftlichen Verhältnissen.
Ist die Entscheidung rechtskräftig, leitet die Staatsanwaltschaft die Geldstrafenvollstreckung ein. Dabei werden unter anderem Mitteilungen an das Bundeszentralregister und andere öffentliche Stellen veranlasst sowie die Übersendung einer Kostenrechnung (Geldstrafe und Gerichtskosten) an die Verurteilten.
Zahlungserleichterungen - Ratenzahlung
Sollten Verurteilte nicht in der Lage sein, die Geldstrafe in Gänze oder den festgesetzten Raten zu zahlen, können mit belegten Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen (z.B. Lohnabrechnung oder Bürgergeldbescheid) bei der Staatsanwaltschaft Zahlungserleichterungen beantragt werden. Diese beinhalten die Gewährung von Ratenzahlung oder eine Herabsetzung der Ratenhöhe. Die Zahlung der Geldstrafe kann unter bestimmten Voraussetzungen auch zeitlich begrenzt gestundet werden. Beides ist schriftlich bei der Staatsanwaltschaft unter Angabe des Aktenzeichens zu beantragen. Die Zahlungserleichterungen dürfen aber nicht so weit gehen, dass die Geldstrafe nicht mehr als Sanktion spürbar ist.
Folgen der Nichtzahlung der Geldstrafe
Sollte die Geldstrafe nicht innerhalb der vorgegebenen Frist gezahlt werden, werden die Verurteilten gemahnt. Nach fruchtlosem Fristablauf ordnet die Staatsanwaltschaft Zwangsvollstreckungsmaßnahmen an. Dies kann beispielsweise die Beauftragung eines Gerichtsvollziehers, die Pfändung des Gehaltes oder von Konten oder ähnliches beinhalten.
Ersatzfreiheitsstrafe
Verläuft die Zwangsvollstreckung erfolglos oder verspricht sie von vornherein keinen Erfolg, werden Verurteilte zum Strafantritt zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe geladen. Ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe entspricht dabei zwei Tagessätzen der Geldstrafe. Verurteilte haben jederzeit die Möglichkeit, die Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe durch Zahlung der Geldstrafe abzuwenden.
Stellen sich Verurteilte auf die Ladung nicht freiwillig, ergeht Haftbefehl. Die Polizei wird beauftragt, den Verurteilten zu verhaften und der Justizvollzugsanstalt zuzuführen. Die Abwendung der Vollstreckung des Haftbefehls ist allerdings noch immer durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe der bestehenden Forderung möglich.
Gemeinnützige Arbeit - Abwendung der Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe
Gemäß der sog. Tilgungsverordnung ist es möglich, die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe auf Antrag des Verurteilten durch Ableistung gemeinnütziger Arbeit abzuwenden. Dabei entsprechen in der Regel fünf Stunden gemeinnützige Arbeit einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe.
Verurteilte erhalten mit der Ladung zum Strafantritt ein Merkblatt mit den wichtigsten Informationen über die Abwendung der Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe. Steht schon frühzeitig fest, dass jemand auf keinen Fall zur Zahlung in der Lage sein wird, muss nicht erst die Ladung abgewartet werden. Vielmehr kann schon von vornherein ein Antrag auf Bewilligung gemeinnütziger Arbeit bei der Staatsanwaltschaft gestellt werden.